Handlungsempfehlungen
bei Ehlers-Danlos-Syndromen

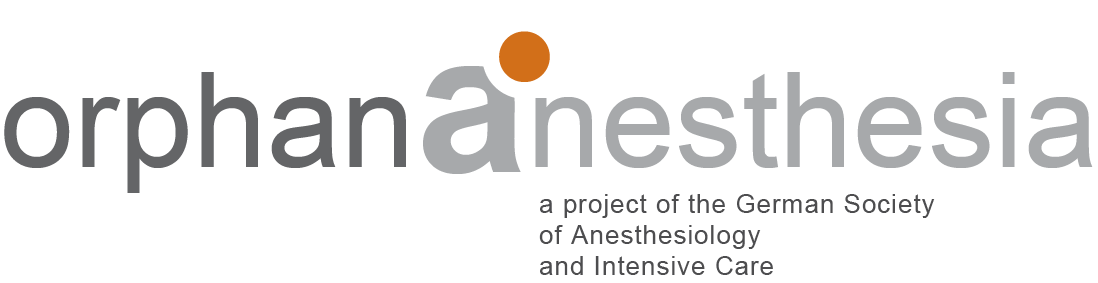
Handlungsempfehlung zur Anästhesie bei Ehlers-Danlos-Syndromen sowie eine Patientenkarte zum Mitführen!
Ziel von OrphanAnesthesia ist die Erhöhung der Patientensicherheit durch die Veröffentlichung von Handlungsempfehlungen zur anästhesiologischen Betreuung von Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen. Die Handlungsempfehlungen bei Ehlers-Danlos-Syndromen werden in deutsch, englisch, spanisch und tschechisch angeboten.
Hier geht es zu den Handlungsempfehlungen >
Außerdem gibt es eine Patientensicherheitskarte für Personen mit einer seltenen Erkrankung. Diese richtet sich an alle Krankenhäuser, Ärztinnen und Ärzte, Patientinnen und Patienten sowie Selbsthilfeorganisationen, die mit seltenen Erkrankungen in Verbindung stehen - ähnlich einem Anästhesieausweis.
Vielen DANK an das OrphanAnesthesia-Team!
Patientensicherheitskarte
Diese Karte gibt dem Team bei einer Narkose, der Schmerztherapie, einer Operation oder einem Notfall wichtige Informationen über Besonderheiten zur Behandlung bei der seltenen Erkrankung und sollte der Anästhesistin oder dem Anästhesisten im bestmöglichen Fall vor der Anästhesie vorlegt werden.
Der Name der jeweiligen seltenen Erkrankung kann auf der Patientenkarte selbst eingegeben werden. Es empfiehlt sich die Patientenkarte für Notfälle stets bei sich tragen. Die Patientenkarte steht ebenfalls in 4 Sprachen zum Download und Ausdruck zur Verfügung.

Handlungsempfehlung zur Stammzellspende
Die DKMS überarbeitet und aktualisiert regelmäßig die Zulassungskriterien für eine Stammzellspende im Rahmen eines internationalen Expertengremiums von Humanmedizinerinnen und Humanmedizinern. Dabei wurde aktuell (03/2025) entschieden, dass ein Ehlers-Danlos-Syndrom pauschal nicht zu einer Spendenrückstellung führt. Die aktuellen Richtlinien berücksichtigen die verschiedenen Typen der Ehlers-Danlos-Syndrome mit jeweils unterschiedlicher führender Symptomatik.
Zulassungskriterien bei Spenderinnen und Spendern mit einem EDS:
Bei Vorliegen eines Ehlers-Danlos-Syndroms mit
- führender hypermobiler Symptomatik,
- ohne häufige, wiederkehrende Blutungen (z.B. häufige punktförmige Einblutungen, rezidivierendes Nasenbluten),
- ohne Wundheilungsstörungen und
- ohne chronische moderate bis schwere Schmerzen
- leichtgradige und milde Schmerzen ohne regelmäßige Schmerzmitteleinnahme sind mit einer Stammzellspende vereinbar
- eine bedarfsweise und gelegentliche Einnahme von Schmerzmitteln ist mit einer Stammzellspende vereinbar
ist eine Stammzellspende möglich.
Hingegen ist bei Vorliegen eines vaskulären Ehlers-Danlos-Syndroms (vEDS) eine Stammzellspende aus Spenderinnen-/Spenderschutzgründen nicht möglich.
Spenderinnen und Spender, welche die oben genannten Voraussetzungen erfüllen, können sich also bei der DKMS zur Stammzellspende registrieren oder auch den Spendenstatus reaktivieren lassen.
Handlungsempfehlung zur Organ- und Gewebespende
Da die Ehlers-Danlos-Syndrome vielfältig in ihrer Ausprägung sein können und so zu verschiedenen Symptomen führen, ist eine eindeutige Aussage zur Organ- und Gewebespende leider nicht möglich.
Eine Organentnahme ist nur dann grundsätzlich ausgeschlossen, wenn bei einer verstorbenen Person eine akute Krebserkrankung oder bestimmte Infektionskrankheiten vorliegen. Eine Krebserkrankung gilt dann nicht mehr als akut, wenn innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss der Therapie keine erneute Krebserkrankung aufgetreten ist. Bei allen anderen Erkrankungen entscheiden die Ärztinnen und Ärzte nach den erhobenen Befunden, ob eine Organ- und Gewebespende infrage kommt. Auch die Einnahme von Medikamenten ist kein grundsätzliches Ausschlusskriterium. Es ist aber hilfreich, Vorerkrankungen oder Allergien auf Ihrem Organspendeausweis im Feld "Platz für Anmerkungen/Besondere Hinweise" zu dokumentieren.
Mehr über die Frage „Wer kann Organe und Gewebe spenden?“ unter:
https://www.organspende-info.de/organspende/voraussetzungen/.
Warnhinweis für den Gebrauch von Fluorchinolon-Antibiotika bei Betroffenen mit Ehlers-Danlos-Syndromen.
Was sind Fluorchinolone?
Fluorchinolone sind eine Gruppe von Antibiotika, die seit Jahrzehnten zur Behandlung bakterieller Infektionen eingesetzt werden. Sie können jedoch schwere Nebenwirkungen verursachen.
Warum ist die Verwendung von Fluorchinolone bedenklich?
Erhöhtes Risiko für Aortenaneurysma, -dissektionen und Herzklappenregurgitation/-insuffizienzen. Insbesondere bei Menschen mit Bindegewebserkrankungen wie einem Ehlers-Danlos-Syndrom kann die Einnahme von Fluorchinolonen das Risiko für diese lebensbedrohlichen Erkrankungen deutlich erhöhen.
Andere schwerwiegende Nebenwirkungen:
Dazu gehören starke Blutzuckerschwankungen, psychische Störungen, irreversible Schäden an Muskeln, Nerven, Sehnen, Gelenken und Bindegeweben.
In einer im Dezember 2018 veröffentlichten Warnung wies die FDA (U.S. Food and Drug Administration) darauf hin, dass die systemische oder inhalative Anwendung von Fluorchinolonen bei Betroffenen mit Ehlers-Danlos-Syndromen oder anderen Bindegewebserkrankungen zu schwerwiegenden Komplikationen führen kann.
Im Februar 2019 hat Swissmedic ebenfalls vor dem Risiko von Aortenaneurysmen und -dissektionen gewarnt, das mit der Einnahme von Fluorochinolonen, sowohl systemisch als auch inhalativ, verbunden sein kann. Diese Warnung wurde in die entsprechenden Arzneimittelinformationen aufgenommen.
Die Ärzteschaft soll diese Antibiotika nur noch in Ausnahmefällen und nach ausführlicher Risiko-Nutzen-Abwägung verschreiben. So steht es in den Rot-Hand-Briefen, die das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 2019 und 2023 veröffentlichte.
Alle in Deutschland zugelassenen Fluorchinolone wie Ciprofloxacin, Levofloxacin, Moxifloxacin, Norfloxacin und Ofloxacin, sind gut an der charakteristischen Endung „floxacin“ erkennbar!
Quellenangaben:
Schmerztherapie und Rezept-Musterverordnung
Low Dose Naltrexone (LDN) – eine vielversprechende Option
Die Behandlung chronischer Schmerzen stellt für viele Betroffene, Ärztinnen und Ärzte eine große Herausforderung dar. Häufig zeigen herkömmliche Medikamente nur eine begrenzte Wirkung oder sind mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden.
Low Dose Naltrexone (LDN) bietet hier eine interessante Alternative:
- Gute Verträglichkeit durch die sehr niedrige Dosierung
- Geringes Risiko für Nebenwirkungen
- Überraschend niedrige Therapiekosten
Besonders bei Fibromyalgie konnte in aktuellen Studien eine positive Wirkung beobachtet werden. Auch bei den Ehlers-Danlos-Syndromen (EDS) wird LDN zunehmend als ergänzende Therapieoption diskutiert.
Anbei der Artikel der Deutschen Schmerzgesellschaft (2023), der Verordnung, Kostenübernahme und Dosierung detailliert beleuchtet: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10200333/
Zusätzliche Informationen zum multimodalen Schmerzmanagement bei EDS bietet dieser weitere Artikel: https://link.springer.com/article/10.1007/s00482-023-00778-7
Die Rezept-Musterverordnungen hat uns Herr Andreas Jelitto (Facharzt für Anästhesiologie, Qualifikation spezielle Schmerzmedizin) zur Verfügung gestellt:
1. Low Dose Naltrexone (LDN)
Rezeptur:
- Naltrexon HCl 1,5 mg / 100 ml Lösung
Dosierungsschema (Tropfen):
- 0-0-1 → 0-0-2 → 1-0-2 → 1-0-3 → 2-0-3 → 2-0-4 usw.
- Primäre Zieldosis: 1,5 mg/Tag = 20 Tropfen
- Sekundäre Zieldosis: 3 mg/Tag = 40 Tropfen
- In Einzelfällen: bis 4,5 mg/Tag
2. Topisches Ambroxol
a) Ambroxol 20% Creme
- Ambroxolhydrochlorid: 10 g
- Mittelkettige Triglyzeride: 5 g
- Basiscreme (Linola): ad 50 g
- Dosierung: 3–4 × täglich dünn lokal auftragen
b) Ambroxol 20% Vaginalcreme
- Ambroxolhydrochlorid: 10 g
- Basiscreme DAC: 20 g
- Propylenglycol: 4 g
- Aqua purificata: 16 g
- Dosierung: 3–4 × täglich dünn lokal auftragen
c) Ambroxol Haarwasser (Spray, 10% Ambroxol in 70 % Ethanol, 100 ml)
- Ambroxolhydrochlorid: 10 g
- Macrogol-40-hydroxglycerolstearat: 2,5 g
- Propylenglycol: 15 g
- Ethanol 90 % (V/V): 48,2 g
- Aqua purificata: 24,3 g
- Dosierung: 3–4 × täglich lokal aufsprühen
⚠️ Hinweis:
Die bereitgestellten Informationen und Rezept-Musterverordnungen dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie ersetzen keine ärztliche Untersuchung, Beratung oder Behandlung. Bitte wenden Sie sich bei gesundheitlichen Fragen immer an Ihre behandelnde Ärztin oder Ihren behandelnden Arzt.
Leitfaden zur Beantragung eines Upright-MRTs bei gesetzlichen Krankenkassen (GKV)
In Deutschland werden Upright-MRTs ausschließlich von Privatpraxen angeboten. Die Kosten für Untersuchungen können daher nicht direkt mit Ihrer gesetzlichen Krankenkasse (GKV) abgerechnet werden. Das liegt an fehlenden direkten Abrechnungsgenehmigungen. Dennoch erfüllt das Upright-MRT die von den GKV vorgegebenen Qualitätskriterien und technischen Anforderungen. Als GKV-Patientin oder Patient werden Sie wie ein Selbstzahler behandelt und schließen einen Behandlungsvertrag mit der Privatpraxis ab. Sie können jedoch unter bestimmten Voraussetzungen vorab eine Kostenerstattung bei Ihrer GKV beantragen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Kostenerstattung
Um eine hoffentlich erfolgreiche Kostenerstattung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Schritte:
1. Medizinische Begründung einholen
Es muss einen fundierten medizinischen Grund geben, warum die Untersuchung in einer Upright-MRT-Praxis und nicht in einer konventionellen radiologischen Praxis durchgeführt werden muss. Häufige Gründe sind:
- Klaustrophobie (Platzangst).
- Klinische Notwendigkeit einer Untersuchung im Sitzen oder Stehen: Dies ist oft der Fall bei starker Luftnot, Morbus Bechterew, starken Schmerzen oder anderen Beschwerden, die eine Lagerung im Liegen unmöglich machen.
- Notwendigkeit von Funktionsaufnahmen: Bei Verdacht auf Wirbelgleiten, Kopfgelenksinstabilitäten (CCI/AAI), Spinalkanalstenose oder ähnliche Zustände sind dynamische Aufnahmen unter Belastung (im Stehen oder Sitzen) notwendig.
- Symptome nur in bestimmten Positionen: Einige Personen haben nur im Stehen oder Gehen Beschwerden, nicht aber im Liegen. Eine Untersuchung in der symptomatischen Position ist daher sinnvoll.
Wichtig:
Die Begründung muss von der überweisenden Ärztin oder des überweisenden Arztes ausgestellt werden und die besondere Problematik/Beschwerden der Person detailliert berücksichtigen. Allgemeine Begründungen wie „Schmerzen“ oder „Angst“ reichen der GKV meistens nicht aus. Entsprechende Vordrucke (z.B. für Funktionsuntersuchung der Wirbelsäule, Klaustrophobie, Untersuchung im Sitzen/Stehen) können Ihnen die Upright-MRT-Praxen zur Verfügung stellen. Ein passendes Begründungsschreiben finden sie hier: https://www.upright-mrt.de/klinische-indikation/kostenerstattung-bei-gkv-patienten/
2. Kostenvoranschlag von der Upright-MRT-Praxis
Nehmen Sie Kontakt mit einer der Privatpraxen für Upright-MRTs auf und bitten Sie um:
- Einen detaillierten Kostenvoranschlag für die geplante Untersuchung.
- Eine Bescheinigung, dass das Upright-MRT die Qualitätsanforderungen erfüllt und den radiologischen Standards entspricht.
3. Antragstellung bei Ihrer GKV
Reichen Sie alle gesammelten Unterlagen zusammen bei Ihrer GKV ein. Dies umfasst:
- Das Begründungsschreiben Ihrer überweisenden Ärztin/Arztes.
- Den Kostenvoranschlag der Upright-MRT-Praxis.
- Die Bescheinigung der Praxis über die Qualitätsanforderungen.
- Ein formloses Anschreiben an Ihre Krankenkasse. Darin sollten Sie ausführlich erläutern, warum Sie ein Upright-MRT benötigen, welche Symptome Sie haben, welchen medizinischen Nutzen Sie sich versprechen und warum andere Untersuchungsmethoden nicht ausreichend sind. Bei bestimmten Diagnosen wie einem Ehlers-Danlos-Syndrom (EDS) kann es hilfreich sein, Publikationen anzufügen, die die Notwendigkeit eines Upright-MRTs untermauern. Hier finden Sie Publikationen: https://www.upright-mrt.de/klinische-indikation/fallstudien-zur-upright-mrt/
Wichtig:
Stellen Sie den Antrag, bevor Sie einen Termin in einer Upright-MRT-Praxis vereinbaren! Setzen Sie sich bei Bedarf persönlich mit Ihrer Krankenkasse in Verbindung, um die Bearbeitung zu beschleunigen. Vereinbaren Sie einen Termin erst, wenn Sie eine schriftliche Kostenzusage Ihrer GKV erhalten haben. Andernfalls müssen Sie ggf. die Kosten selbst tragen. Sollte die Untersuchung aufgrund der Dringlichkeit Ihrer Symptomatik sofort erfolgen müssen, können Sie direkt einen Termin vereinbaren. Die Chancen auf Kostenerstattung sind dann jedoch erfahrungsgemäß geringer.
Was tun bei Ablehnung des Antrags?
Seien Sie darauf vorbereitet, dass Ihre Krankenkasse den Antrag zunächst ablehnen könnte.
- Widerspruch einlegen: Im Falle einer Ablehnung haben Sie in der Regel 4 Wochen Zeit, Widerspruch einzulegen. Die genaue Frist entnehmen Sie dem Ablehnungsschreiben Ihrer Krankenkasse.
- Begründung des Widerspruchs: Begründen Sie Ihren Widerspruch erneut ausführlich und verweisen Sie auf alle bereits genannten Argumente und beigefügten Unterlagen.
- Bearbeitungsfristen: Die GKV hat eine dreiwöchige Bearbeitungsfrist. Zieht die Krankenkasse den Medizinischen Dienst hinzu, verlängert sich die Frist auf fünf Wochen. Für Widersprüche gibt es keine feste Bearbeitungsfrist. Bleiben Sie geduldig und kontaktieren Sie Ihre Krankenkasse bei Bedarf erneut.
Dieser Leitfaden dient lediglich der allgemeinen Information und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Klären Sie alle offenen Fragen stets mit Ihrer behandelnden Ärztin oder Ihrem Arzt, Ihrer Krankenkasse oder einem Rechtsanwalt.

